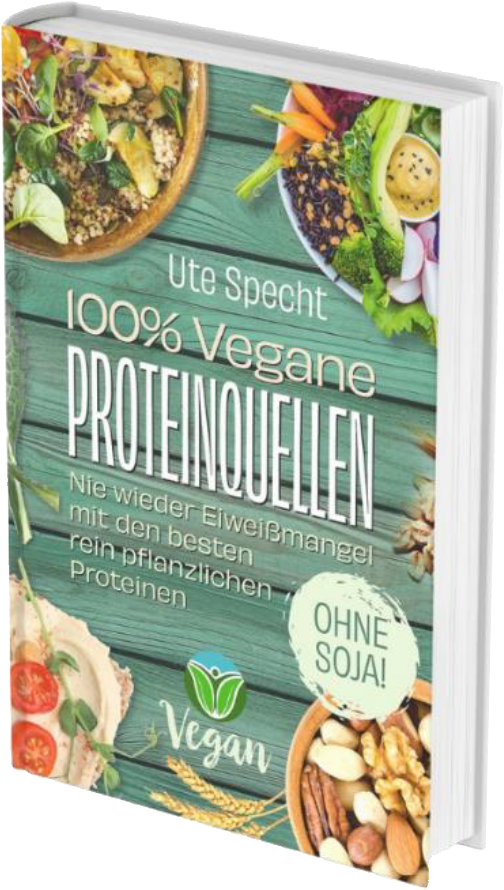16 Mai, 2024 | Allgemein, Kultur, Lifestyle, Lokales

Judas Priest 2024, Foto: Andy „Elvis“ Mcgovern I
Judas Priest kommen nach Hamburg!
Invincible Shield Tour – Europe 2024
Wegen großer Nachfrage: Weitere Arena-Shows für Sommer 2024 wurden angekündigt.
Judas Priest haben ihre Rückkehr nach Deutschland für Juli 2024 mit fünf weiteren Arena-Shows angekündigt. Unter dem Banner „Invincible Shield Tour – Europe 2024“ spielen Judas Priest in Hamburg am 01.07.2024 in der Barclays Arena.
Weitere Termine:
02.07.2024 Berlin, Max-Schmeling-Halle
04.07.2024 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung
08.07.2024 Mannheim, SAP-Arena
10.07.2024 Dresden, Messe Dresden, Halle 1
Präsentiert von: Metal Hammer
Special Guest: Saxon & Uriah Heep* (*nicht in Mannheim)
Über Judas Priest:
In den vergangenen 50 Jahren haben Judas Priest weltweit mehr als 50 Millionen Alben verkauft und in den größten Stadien der Welt gespielt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine starke, einzigartige Identität, die sowohl Judas Priest definiert als auch zukünftige Generationen von Metal-Bands auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Mit jedem Jahr wächst die Legende Priest weiter; 2022 wurden sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen und absolvierten eine ausverkaufte, verschobene Welttournee anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens.
– Anzeige –
Tickets gibt es u. a. hier (klicken)
15 Mai, 2024 | Allgemein, Kultur, Lifestyle, Lokales

Tiziana Turano, Maik Lohse, Kristin Riegelsberger, Philip Lüsebrink
Foto: ©Markus Richter
„ABBA KLARO!“ Komödie im hoftheater mit den größten Hits von ABBA!
von Oliver Geilhardt
Benni, der ehemalige Sänger der Abba-Coverband BABBA, steht mit dem Rücken zur Wand. BABBA ist lange aufgelöst und all seine Karrierepläne sind in Flammen aufgegangen. Und nun wird er auch noch von einem brutalen Mafioso mit dem Tode bedroht. Ihm bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder er kommt in wenigen Tagen an eine große Summe Geld oder … ums Leben. Benni entscheidet sich für Letzteres. Doch dann tut sich eine dritte Möglichkeit auf und Benni geht volles Risiko, um sein Schicksal noch ein letztes Mal in die Hand zu nehmen. Ob ihm dies gelingt und was Nagelpflege, Hundefutter, Bier und enttäuschte Liebe damit zu tun haben, klärt sich im Laufe des Abends. Und am Ende erlebt das Publikum ein ABBA-Konzert der Extraklasse.
Ein Muss – garantiert nicht nur für Fans der schwedischen Superband. Eine verrückte Geschichte und jede Menge Abba-Kultsongs, nachhaltig beschwingend und auf wunderbare Weise unterhaltend. Thank You For The Music, ABBA!
Regie: Stefan Leonard
Musikalische Leitung: Timo Riegelsberger
Choreografie: Stefanie Schwendy
Mit Philip Lüsebrink, Vera Gobetz, Kristin Riegelsberger, Maik Lohse
Termine: 24. Mai – 09. Juni 2024
Preise: Euro 35,-
Das kleine hoftheater · Bei der Martinskirche 2 · 22111 Hamburg
14 Mai, 2024 | Allgemein, Kultur, Lifestyle, Lokales

Willemijn Verkaik (Anne Hathaway), Chiara Fuhrmann (Julia), Raphael Groß (Romeo) und Andreas Bongard (William Shakespeare) / Morris Mac Matzen
Hit-Musical & JULIA: Das sind die vier Hauptdarsteller:innen
Erst vor wenigen Tagen hat Stage Entertainment in New York die Hauptdarstellerin des erfolgreichen, vielfach ausgezeichneten Hit-Musicals & JULIA vorgestellt: Chiara Fuhrmann. Neben Chiara Fuhrmann werden die bekannten Musical-Stars Raphael Groß, Andreas Bongard und Willemijn Verkaik in die Rollen von Julia und Romeo sowie William Shakespeare und seiner Frau Anne Hathaway schlüpfen. Die Deutschlandpremiere von & JULIA wird Ende Oktober im Stage Operettenhaus gefeiert.
Für Chiara Fuhrmann ist es die Erfüllung eines großen Traums: Die Osnabrückerin spielt als Julia zum ersten Mal eine Titelrolle. Dabei ist für ihren Neuanfang in & JULIA eigentlich eine ganz andere Figur verantwortlich: William Shakespeares Frau Anne Hathaway, gespielt von Musical- und Broadwaygröße Willemijn Verkaik, macht aus dem Ende der berühmten Liebesgeschichte ihres Mannes den Beginn einer rasant-bunten Komödie, in der das 16. Jahrhundert auf Pop-Culture trifft. Da sie mit dem tragischen Ende, das ihr Mann William für Romeo und Julia vorgesehen hat, nicht zufrieden ist, bringt sie sich kurzerhand selbst als Co-Autorin ein: „Anne hat diese Idee: ‚Was, wenn Julia sich nicht umbringt?‘ und schreibt die bekannte Geschichte vor den Augen der Zuschauer:innen um“, so Willemijn Verkaik. „Ich freue mich schon sehr darauf, diese fröhliche, selbstsichere Frau zu spielen, die alles mit viel Humor angeht. Die Musik und die Energie machen das Musical zu einer richtigen Party!“
Über & JULIA – das Hit-Musical
Mit Songs des legendären Grammy-preisgekrönten Songwriters und Produzenten Max Martin, einem Buch des Emmy-preisgekrönten Autors von „Schitt’s Creek“, David West Read, Regie von Luke Sheppard und Choreografie von der Emmy-Gewinnerin Jennifer Weber, dreht & JULIA die Handlung der größten Liebesgeschichte aller Zeiten um und fragt: Was würde passieren, wenn sich Julia nach Romeos Tod für das Leben entscheidet? Und so beginnt eine fabelhafte Reise, auf der Julia ihr berühmtes Ende für einen frischen Anfang nutzt – und eine zweite Chance auf das Leben und die Liebe erhält.
Julias neue Geschichte erwacht durch eine Playlist von zahlreichen weltbekannten Pop-Hymnen zum Leben, darunter „Since U Been Gone“ von Kelly Clarkson, „Roar“ von Katy Perry, „Baby One More Time“ von Britney Spears, „Larger Than Life“ von den Backstreet Boys, „That’s the Way It Is“ von Celine Dion und „Can’t Stop the Feeling!“ von Justin Timberlake. Alle diese Lieder stammen aus der Feder eines einzigen, genialen Songwriters und Produzenten: Der Schwede Max Martin steckt hinter mehr Nummer-1-Hits als jeder andere Künstler dieses Jahrhunderts.
Die Deutschlandpremiere von & JULIA findet im Oktober 2024 im Stage Operettenhaus statt, wo bis dahin TANZ DER VAMPIRE aufgeführt wird. Es ist die erste Produktion der Show, in der die Dialoge in eine andere Sprache übersetzt werden. Denn sämtliche Pop-Hymnen bleiben auch in der deutschen Show im englischen Original. Mehr Informationen über alle Produktionen auf www.andjulietthemusical.com.
– Anzeige –
Tickets gibt es u. a. hier (klicken)
7 Mai, 2024 | Allgemein, Kultur, Lifestyle, Lokales, Veranstaltungen
 Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz
Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz
Vom 9. – 12. Mai verwandelt sich der Hamburger Spielbudenplatz für vier Tage in ein internationales Schlaraffenland: Das Food Truck Festivalist endlich wieder zurück im Herzen der Reeperbahn und lädt Feinschmecker und Genießer zu einer kulinarischen Weltreise ein. An vier Tagen gibt es leckerstes Street Food von den verschiedenen Kontinenten der Erde zu verköstigen. Über 20 Food Trucks mit Essen aus aller Welt präsentieren an diesem Wochenende ihre vielfältigen Spezialitäten und bieten den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, in verschiedenste Länderküchen einzutauchen.
Von süß bis herzhaft: Für jeden Geschmack etwas dabei
Ob süße Waffeln und Kaffeespezialitäten, erfrischendes Eis oder Herzhaftes wie Burger oder Hot Dogs – das Food Truck Festival bietet für jeden Geschmack etwas. Marokkanische Gerichte von Jamila Idbella, syrisches Street Food von Diarfest oder schwäbische Pizza von Dinnede, südindische & malaysische Spezialitäten von Curry Bites, türkische Spezialitäten von Dice Kitchen, Fischspezialitäten von HAVN Copenhagen, mexikanisches Essen von Miss Taco und viele weitere Trucks sorgen für kulinarische Abwechslung. Selbstverständlich kommen auch Vegetarier und Veganer beim Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz auf ihre Kosten.
Neben dem vielfältigen kulinarischen Angebot wird das Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz mit Livemusik und kühlen Drinks an den Bars im Biergarten sowie auf dem Sommerdeck abgerundet.
Der Eintritt zum Food Truck Festival ist natürlich wie immer frei!
—
Food Truck Festival
Ort: Spielbudenplatz
Datum: 09. – 12. Mai 2024
Öffnungszeiten: Donnerstag von 16:00 bis 23:00 Uhr, Freitag von 16:00 bis 23:00 Uhr, Samstag von 12:00 bis 23:00 Uhr, Sonntag von 12:00 bis 20:00 Uhr
24 Apr., 2024 | Allgemein, Kultur, Lifestyle, Lokales

Bild: bergmanngruppe.de
Traditioneller Charme und moderne Vibes beim 41. Eppendorfer Landstraßenfest
Gute Stimmung und tanzende Eppendorfer:innen: Am ersten Juni-Wochenende wird das beliebte Straßenfest im Herzen Eppendorfs wieder zum pulsierenden Treffpunkt für Kreativität und Gemeinschaft. Mit Live-Musik und Attraktionen wie dem Kreativmarkt, Engagement aus dem Stadtteil und dem Anliegerflohmarkt zeigt sich Eppendorf von seiner besten Seite. Die Highlights in diesem Jahr:
- Musik und Live-Performances: Auf mehreren Bühnen entlang der Eppendorfer Landstraße wird eine bunte Mischung aus Musik und Tanz geboten. Die Genres auf der Bühne Ecke Goernestraße decken sowohl Pop und Rock als auch Soul und Musik im Singer-Songwriter-Stil ab.
- Wein, Street Food und regionale Spezialitäten: Der vergrößerte Winzerbereich am Eppendorfer Marktplatz bietet seit dem vergangenen Jahr gehobenen Genuss bei passender Live-Musik direkt am Entrée des Stadtteilfestes. Auch ein buntes, internationales Streetfood-Angebot mit Veganem, Burgern, Bowls oder Waffeln sorgt für kulinarische Vielfalt.
- Activity und Kinderaktionen: Wer kann ein volles Getränketablett in Windeseile durch den Parkour manövrieren? Dieser temporeichen Aufgabe stellen sich Vertreter der Eppendorfer Gastronomien beim unterhaltsamen Kellner-Rennen. Für Kinderspaß ist auf dem Marie-Jonas-Platz gesorgt.
- Kunst und Kreativität: Wie in einer Open-Air-Galerie kann man nicht nur die Werke unterschiedlichster lokaler Künstler:innen, Kunsthandwerker:innen und Designer:innen bestaunen und erstehen – man kann ihnen bei der Arbeit auch über die Schulter schauen. In ihren Manufakturen entstehen hochwertige Mode, handgemachter Schmuck, außergewöhnliches Kunsthandwerk und handgemachte Delikatessen.
- Community und soziales Engagement: In der Vereinsmeile „Eppendorfer Leben“ stellen Vereine, Organisationen, Sozialeinrichtungen, Parteien und Initiativen aus Eppendorf ihre Arbeit vor. Auf dieser vom Veranstaltenden finanzierten Meile treten diese mit der Gemeinschaft in Kontakt und sorgen mit verschiedenen Mitmach-Aktionen für Abwechslung. Über 30 Meter Butterkuchen werden gespendet und der Verkaufserlös geht vollständig an den Förderverein Kinderkrebszentrum e. V. Außerdem wird sich wieder der gemeinnützige Verein Amigos de los Ninos e. V. mit Herzblut für den Schulbesuch von Kindern in Mexiko City engagieren, informieren und Spenden sammeln.
- Großer Stadtteil-Flohmarkt: Die Eppendorfer Landstraße verwandelt sich in einen lebendigen Marktplatz mit circa 200 Ständen. Hier stellen an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr vordergründig Eppendorfer Bewohner:innen ihre Schätze zum Verkauf.
- Nachhaltigkeit und Innovation: Das Eppendorfer Landstraßenfest setzt nachhaltige Akzente. Auch in diesem Jahr können sich Gastronomien als Partner:innen für die Grüne Gabel zertifizieren lassen und müssen dabei gewisse Kriterien erfüllen wie beispielsweise den regionalen Bezug der Produkte, vegane und vegetarische Alternativen, einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Ab sofort gilt auch eine Mehrwegpflicht für die Gastronom:innen der Veranstaltung
Das ausführliche Programm ist stets aktuell unter www.eppendorfer-landstrassenfest.de.
23 Apr., 2024 | Allgemein, Kultur, Lifestyle, Lokales, Veranstaltungen


 Am 6. April feierte Circus Europa Premiere in Hamburg und gastiert noch bis zum 20.5.2024 auf der Moorweide. Den Besucher erwartet eine gigantische Show mit Spitzenartisten aus aller Welt. Beste Unterhaltung u. a. mit Star-Artisten, Top-Comedians und großem Show-Ballett bietet der Familienzirkus Europa für Groß und Klein.
Am 6. April feierte Circus Europa Premiere in Hamburg und gastiert noch bis zum 20.5.2024 auf der Moorweide. Den Besucher erwartet eine gigantische Show mit Spitzenartisten aus aller Welt. Beste Unterhaltung u. a. mit Star-Artisten, Top-Comedians und großem Show-Ballett bietet der Familienzirkus Europa für Groß und Klein.
Gönnen Sie sich für ein paar Stunden Urlaub vom Alltag. Tauchen Sie ein in eine zauberhafte Welt voller Magie und Wunder. Lassen Sie sich von internationalen Spitzenartisten, preisgekrönten Tierdressuren und herzerfrischenden Clowns in eine Welt der 1000 Möglichkeiten entführen! Begleitet wird die Show von Live-Gesang, modernem Sound- & Lichtdesign.
Weitere Informationen unter http://circus-europa.de
Verlosung
Die Alster Rundschau verlost 5x 2 Karten für Freitag, den 26.04.2024. Wer gewinnen möchte, sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Circus Europa“, Ihrem Namen und Adresse an:
gewinnspiel@auc-hamburg.de.
Einsendeschluss ist der 25.04.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

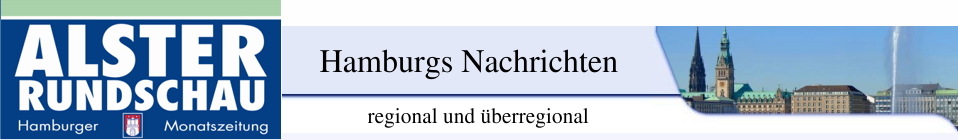


 Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz
Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz


 Am 6. April feierte Circus Europa Premiere in Hamburg und gastiert noch bis zum 20.5.2024 auf der Moorweide. Den Besucher erwartet eine gigantische Show mit Spitzenartisten aus aller Welt. Beste Unterhaltung u. a. mit Star-Artisten, Top-Comedians und großem Show-Ballett bietet der Familienzirkus Europa für Groß und Klein.
Am 6. April feierte Circus Europa Premiere in Hamburg und gastiert noch bis zum 20.5.2024 auf der Moorweide. Den Besucher erwartet eine gigantische Show mit Spitzenartisten aus aller Welt. Beste Unterhaltung u. a. mit Star-Artisten, Top-Comedians und großem Show-Ballett bietet der Familienzirkus Europa für Groß und Klein.